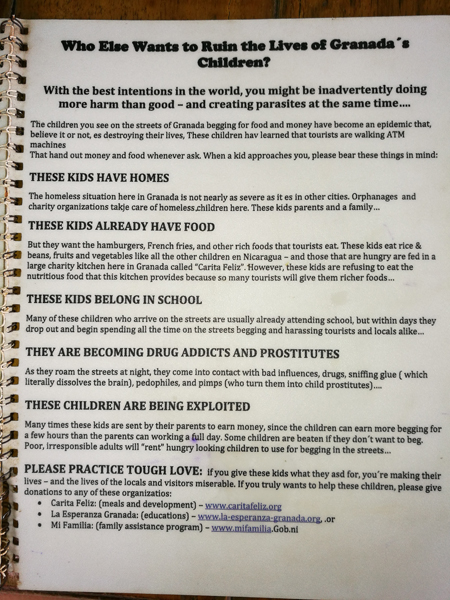San Blas – Das Paradies
Der Wecker klingelte um 4:30 Uhr. All unsere Sachen waren gepackt. Nein, es ging nicht nach Hause, sondern auf den letzten und angenehmsten Teil unserer Reise.
Heute würde wir für drei Tage auf die Inseln des San Blas Archipels im karibischen Meer fahren.
Wir hatten zuvor mit dem Hotel ausgemacht, dass wir während unseres Aufenthalts auf der Insel den Hauptteil unsere Sachen dort lagern konnten und für die letzten zwei Nächte wieder zurück nach Panama City kommen würden, bevor es zurück nach Deutschland ginge.
Wir wurden also mit einem kleinen Lunchpaket ausgestattet und warteten in der Lobby auf unseren Fahrer.
Das Archipel San Blas besteht aus 365 Inseln, wovon 57 bewohnt sind, die sich entlang der Karibikküste Panamas bis nach Kolumbien erstrecken.
Und diese Inseln sind der Stereotyp dessen, an was man denkt, wenn man eine karibische Trauminsel im Kopf hat. Wenn man im Reisebüro einen Katalog aufschlägt und einem Bilder von Inseln entgegen strahlen, auf denen vor weißem Sandstrand ein türkisblaues Meer leuchtet, dann sind diese Bilder meistens hier aufgenommen. Teilweise sind die Inseln so klein, das gerade einmal drei Palmen und eine Buschhütte auf ihnen Platz finden, alles umrahmt von blauem, wolkenlosem Himmel und kalkweißen Muscheln im ebenso weißem Sand. Das Wasser ist so klar, dass man darin gefühlt kilometerweit sehen kann. Ein Paradies für Schnorchler und Sonnenanbeter gleichermaßen.
Und dort sollte es für uns hingehen: auf die Insel mit dem nicht ganz so einladenden Namen „Isla Diablo“.
Wir waren wirklich aufgeregt, zum teil aus Vorfreude, zum Teil aus Angst.
Denn selbst bei diesem Paradies gibt es einen kleinen Haken. Alle diese Inseln sind selbstverwaltet vom Volk der Kuna, einem indigenen Stamm, der sich ausschließlich auf diesen Inseln aufhält.
Man kann in diversen Reiseblogs lesen, dass es auf den Inseln weder fließendes Süßwasser noch Strom gibt. Die Hütten hätten keinen Boden und man würde im Sand schlafen. Man hätte keinen Handyempfang und das einzige Essen, das man bekommt, besteht aus Reis und Bohnen… drei mal am Tag. Duschen bestehen aus Tonnen mit Meerwasser, das man mit Eimern schöpft und sich daraus wäscht. Und die Klos…
Wir sollten sehen, was uns erwarten würde. Erstmal kam unser Fahrer mit nur 20 Minuten Verspätung (was für zentralamerikanische Verhältnisse erstaunlich pünktlich ist!) um uns abzuholen. Sein Fahrzeug war ein Toyota Fortuner Geländewagen, der schon mit vier anderen Touristen besetzt war.
Wir wurden auf dem Weg noch an einem Supermarkt rausgelassen, damit wir noch ein paar Kleinigkeiten kaufen konnten. Für den Fall, dass es wirklich nur Bohnen und Reis geben sollte.
Also deckten wir uns noch mit ein paar Keksen und Trinkwasser ein und schon waren wir auf der Autobahn aus Panama City raus und Richtung Karibikküste.
Die Fahrt sollte knapp zwei Stunden für die 80 Kilometer auf die andere Seite des Landes betragen, danach würde es mit dem Boot nochmal eine Stunde auf die Inseln gehen.
Im Auto stieg die Vorfreude und die Spannung gleicher Maßen. Das letzte Stück des Weges fuhren wir über eine hügelige Teerstraße, die mitten durch den Urwald führte. An manchen Stellen konnte man durch den Dschungel schon die Küste und das türkisfarbene Wasser erkennen.
Auf unserem Weg reihten sich immer mehr Fahrzeuge hinter uns ein. Selbst hier hält der Massentourismus Einzug. Der Traum vom einsamen Inselidyll zerplatzte in dem Moment, als wir an einem Checkpoint anhalten mussten, um unsere Pässe zu zeigen und die gefühlt 300 Autos vor uns sahen.
Am Hafen… Nein, besser gesagt an der Bootsanlegestelle wurde wir rausgelassen und angewiesen, uns auf die Bänke zu setzen, die für unsere jeweiligen Inseln vorgesehen wären. Die Schilder der einzelnen Destinationen waren mit Hand direkt auf die Pfosten geschrieben, die das Dach hielten, die Bänke grob zusammengezimmert. Den ersten Vorgeschmack gab das dortige Klo, das Händewaschen war nur mit dem erwähnten Eimer zu erledigen.
Uns schwante Übles…
Kurz darauf wurden wir aufgefordert, uns zu unserem Boot zu begeben – einem kleinen Kahn für vielleicht 15 Personen. Der wurde mit Touristen vollgestopft und legte direkt nach unserem Einsteigen ab.
Als wir die Küste verließen wechselte das Wasser sofort die Farbe von hellem oliv in strahlendes Türkis. Wir machten noch Halt an einer ersten Insel um Lebensmittel für das Abendessen einzuladen.
Als das Boot beladen wurde und wir uns die Insel betrachteten, kam uns zwangsläufig das Atoll aus dem Film Waterworld in den Sinn. Die eine Seite war weit in den Ozean hin auf Stützen überbaut und die Gebäude waren so zusammengestückelt, das es nicht verwunderlich gewesen wäre, wenn sie einfach vor unseren Augen zusammengestürzt wären. Die andere Seite bestand, leider Gottes, mehr aus Müll wie aus Insel.
Als wir wieder ablegten, beteten wir insgeheim, dass wir die richtige Entscheidung getroffen hatten, drei Nächte hier zu bleiben…
Aber als wir unsere Insel eine halbe Stunde später erreichten, atmeten wir erleichtert auf. Unsere Hütte, die uns für die nächsten drei Nächte ein Dach über dem Kopf bieten würde, war solide gebaut und… naja, sagen wir fast neu.
Es gab fließend Wasser und die Mahlzeiten konnte man frei wählen. Zwar war die Auswahl etwas fischlastig, aber zumindest kein Reis mit Bohnen.
Das Paradies durfte kommen!
Wir verbrachten drei wunderschöne Tage auf der Isla Diablo. Meine Angst, mir könnte langweilig werden, war unbegründet, denn wir hatten den ganzen Tag zu tun. Es wurden kostenlose Ausflüge auf anderen Inseln angeboten, an denen man einfach teilnehmen konnte, wann immer man wollte. Man konnte schnorcheln, das Wasser war so klar und so voll Fische und Korallen, dass man sich zwingen musste, zurück an Land und in den Schatten zu gehen, damit man sich nicht vor Sonnenbrand am Abend die Haut vom Rücken ziehen musste. Oder man lag einfach im weißen Sand, baute Burgen mit seiner Tochter oder spazierte über die Insel. Okay, war ein Witz, denn unsere Insel war so klein, dass wir, um sie einmal zu umrunden, keine fünf Minuten brauchten. Und das mit einer Zweijährigen an der Hand, die jede Muschel und jeden Stein aufhebt.
Das einzige Manko war jedoch, dass auf jeder Insel im Archipel Drohnenflugverbot herrscht.
Auf der einen Seite verständlich, denn auch ich wollte nicht, dass alle fünf Minuten ein Tiefflieger über meinen Kopf ziehen würde und das permanente Sirren der Rotoren zu hören wäre.
Auf der anderen Seite konnte man das ganze Ausmaß der Schönheit dieser Region nur effektiv aus der Luft erkennen… Ein Dilemma.
Aber Abhilfe wurde geschaffen, denn es war nur „auf den Inseln verboten eine Drohne zu starten“, nicht aber auf einem Schiff!
Also nahmen bei jedem Ausflug die Drohne mit, und wenn alle anderen sich am Strand sonnten, blieben wir auf dem Boot und erkundeten die Umgebung aus der Luft.
So vergingen die Tage rasend schnell und der Morgen der Abreise rückte unerbittlich näher.
Aber zuvor wurden wir noch von einer kanadischen Schulklasse eingeladen, sie auf ihrem privaten Ausflug zu begleiten.
David Fehr und seine Schulklasse, bestehend aus dreißig Schülern, waren Teil eines Projektes mit dem Namen Students without Borders Acadamy.
Dieses Programm ermöglicht es den Jugendlichen, fern ab der Heimat aus dem wahren Leben zu lernen. Sie besuchen indigene Dörfer, machen Schulunterricht am Strand und gehen in Nationalparks, anstatt in öden Klassenzimmern zu büffeln.
Sarah verglich dieses System ein wenig mit einer Waldorfschule, aber mir persönlich gefällt es wirklich gut und wo lernt man besser als vom wahren Leben!

Da man auf einer so kleinen Insel überhaupt keine andere Wahl hat, als sich zwangsläufig mit seinen Teilzeitinsulaner-Kollegen anzufreunden, waren wir schnell mit allen Schülern und Lehrern bekannt. Natürlich trug auch unsere Tochter wiedermal zu einer schnelleren Kontaktaufnahme bei, denn wie immer war sie der Hit am morgendlichen Frühstückstisch.
So lud uns David also auf ihren letzten Trip ein, bei dem wir die Hauptinsel besuchen und danach den Abend auf einem winzigen Eiland beim Baden und sonnen ausklingen lassen würden. Denn auch für die Kanadier würde es am nächsten Tag zurück aufs Festland gehen. Der Tag war überragend und wir genossen die Zeit mit den Schülern enorm.
Beim Abendessen tauschten wir noch Nummern und diverse Karten aus, damit wir in Kontakt bleiben konnten und uns gegenseitig all unsere gemachten Bilder schicken konnten!
Für alle, die sich für das Projekt interessieren, die Homepage ist swba.ca oder unter facebook students without borders acadamy
Resümee über das Paradies
Dass San Blas ein karibisches Paradies ist, bleibt unbestritten. Und ich muss auch allen Bloggern den Zahn ziehen, dass man dort Robinson-Crusoe-mäßig jeden Tag um sein Überleben kämpfen muss und all abendlich hungrig ins Bett geht. Wobei das mit dem hungrig ins Bett schonmal passieren kann, da die Portionen nicht die aller größten sind.
Man findet dort Trauminseln, wenn man bereit ist, sich auf ein paar Kleinigkeiten einzulassen, die aber allgemein bekannt sind.
Zum Beispiel sucht man eine Klimaanlage hier vergebens, genauso wie eine Poolbar oder den Zimmerservice.
San Blas und seine Inseln sind rudimentär und auf das Nötigste beschränkt. Kaum anders zu erwarten, wenn selbst die kleinste Schraube per Schiff angeliefert werden muss.
Wenn man bereit ist, auf einfachen Bettgestellen und in Holzhütten zu übernachten, überwiegend Fisch zu essen und einem sein gewohnten Luxus in diesem Bezug mal für drei Tage egal ist, findet man hier ein Erlebnis, dass man niemals vergisst und sieht Dinge, das man sonst nur aus Katalogen kennt.
Wir haben unsere Zeit auf den Inseln sehr genossen, mussten aber auch feststellen, dass es ein paar Sachen gibt, die die Karibikidylle ein wenig trüben.
Wovon man sich definitiv verabschieden kann, ist der Gedanke, alleine auf einer tropischen Insel zu sein und den ganzen Tag Cocktails aus Kokosnüsse zu schlürfen. Die Inseln werden zum Teil bis zum bersten mit Touristen vollgestopft, wobei gerade die aus Panama stammenden sich benehmen wie die Axt im Walde. Rauchverbot, scheiß egal. Morgens um 8 Uhr das erste Bier, nur rein damit…
Teilweise rücken sie mit ihren eigenen batteriebetriebenen Jukeboxen an und beschallen alles im Umkreis mit lateinamerikanischem Rap, wobei eine löchrige Holzhütte da nicht wirklich lautstärkedämmend funktioniert.
Wir waren über ein Wochenende auf der Isla Diablo und auf der gegenüberliegenden Isla Perro konnte man den Strand vor lauter Menschen mit Day-Pass nicht mehr sehen.
Und zu der Geschichte mit dem Empfang… Man konnte keine zwei Atemzüge machen, ohne das nicht aus irgendeiner Ecke ein Handy anfing zu klingeln, soviel zu dem Funkloch.
Was uns auch aufgefallen ist, aber das ist eine rein subjektive Ansicht und (hoffentlich) nicht auf allen Inseln so, dass die dort wohnenden Kuna, die auch das „Hotel“ betrieben, morgens nach dem Frühstück die Kaffeetasse gegen die Bierdose tauschten und bis abends praktisch nur eine Hand frei hatten, wenn ihr versteht was ich meine…
Als wir mit den Kanadiern auf der Hauptinsel waren, bestätigte sich unser Verdacht aber zusehends, denn dort trafen wir auf einen Kuna, der uns auf fast perfektem Deutsch ansprach. Er hätte dreizehn Jahre in Deutschland gelebt und Kinder dort. Somit seinen wir praktisch seine Familie und er würde uns durch das Dorf führen. Dort fand gerade eine Feier statt, bei der die erste Periode eines Dorfmitglieds gefeiert wurde. Er erklärte uns, und ich zitiere wörtlich: „an Tagen wie diesen muss das ganze Dorf besoffen sein!“ Als ich mich umsah und mal grob überschlug, wie viele Mädchen bald in das entsprechende Alter kommen würden, wollte ich mir nicht ausmalen, wie viele Tage im Jahr ein solches Besäufnis statt finden würde.
Wir wissen nicht, ob es durch die eigenständige Selbstverwaltung der indigenen Kuna zu diesen Eigenheiten kommt, und ob es anders wäre, wenn die Regierung zumindest ein wenig die Hand über die Organisation halten würde.
Wie dem auch sei, wir gingen mit den schlimmsten Erwartungen auf das Archipel und wurden positiv überrascht. Die Panikmache war unbegründet, es wäre aber auch deutlich mehr gegangen, wenn ein paar organisatorische Feinheiten verbessert werden würden. Dann wäre es das hundertprozentige Paradies!

Abschied
Zurück in der Hauptstadt bezogen wir wieder ein Zimmer im Hotel, dieses Mal leider keine Suite, aber trotzdem sehr schick. Die letzten zwei Tage ließen wir es ganz entspannt angehen und bereiteten uns langsam aber sicher auf unsere baldige Abreise vor.
Deutschland würde uns mit eisigen Temperaturen und miesem Wetter erwarten, aber auch mit dem Blick in die Zukunft und dem letzten Teil unserer Weltreise:
Ab Frühjahr wird es für uns entlang der Seidenstraße in Richtung Osten gehen, Iran und der Pamir Highway erwarteten uns. Ein ganz neues Abenteuer! Wir sind gespannt…
Und bis dahin sagen wir DANKE Mittelamerika! Es war eine tolle Zeit!